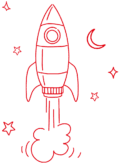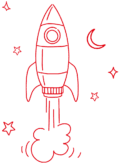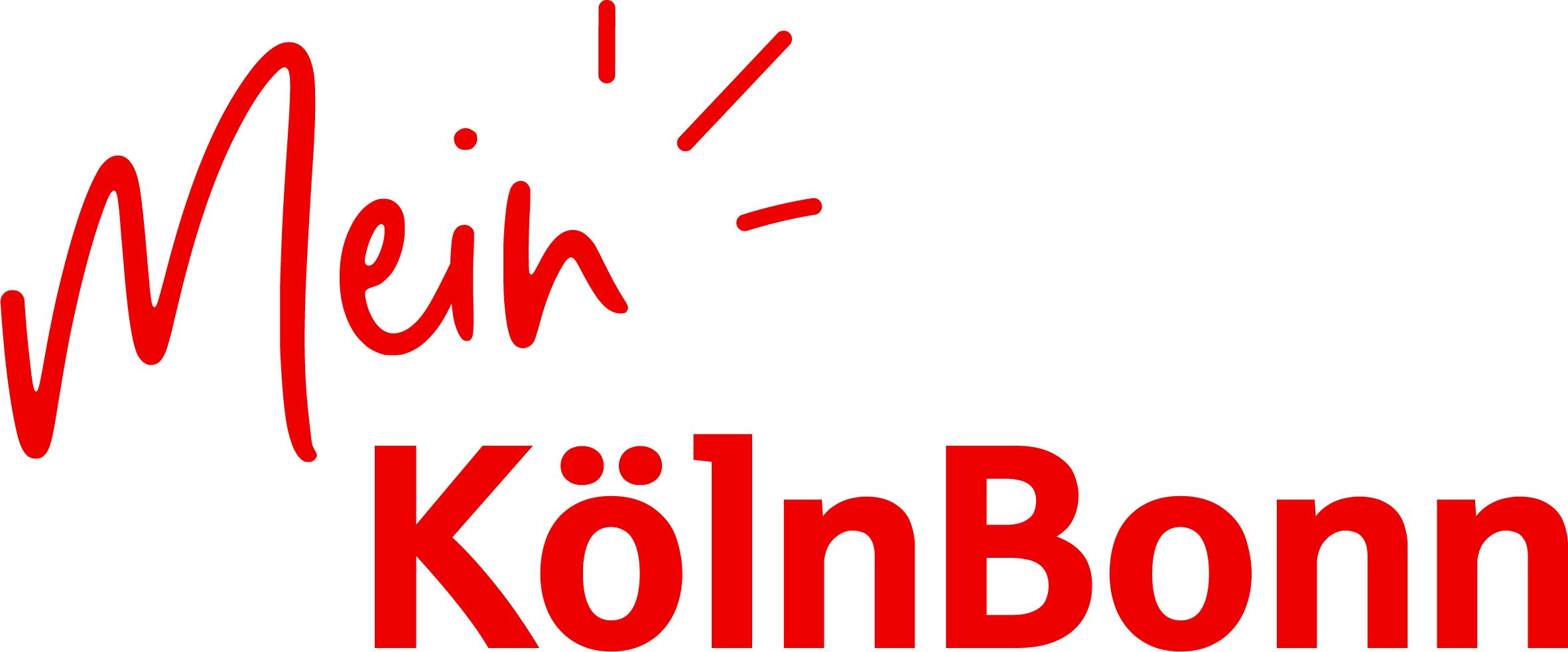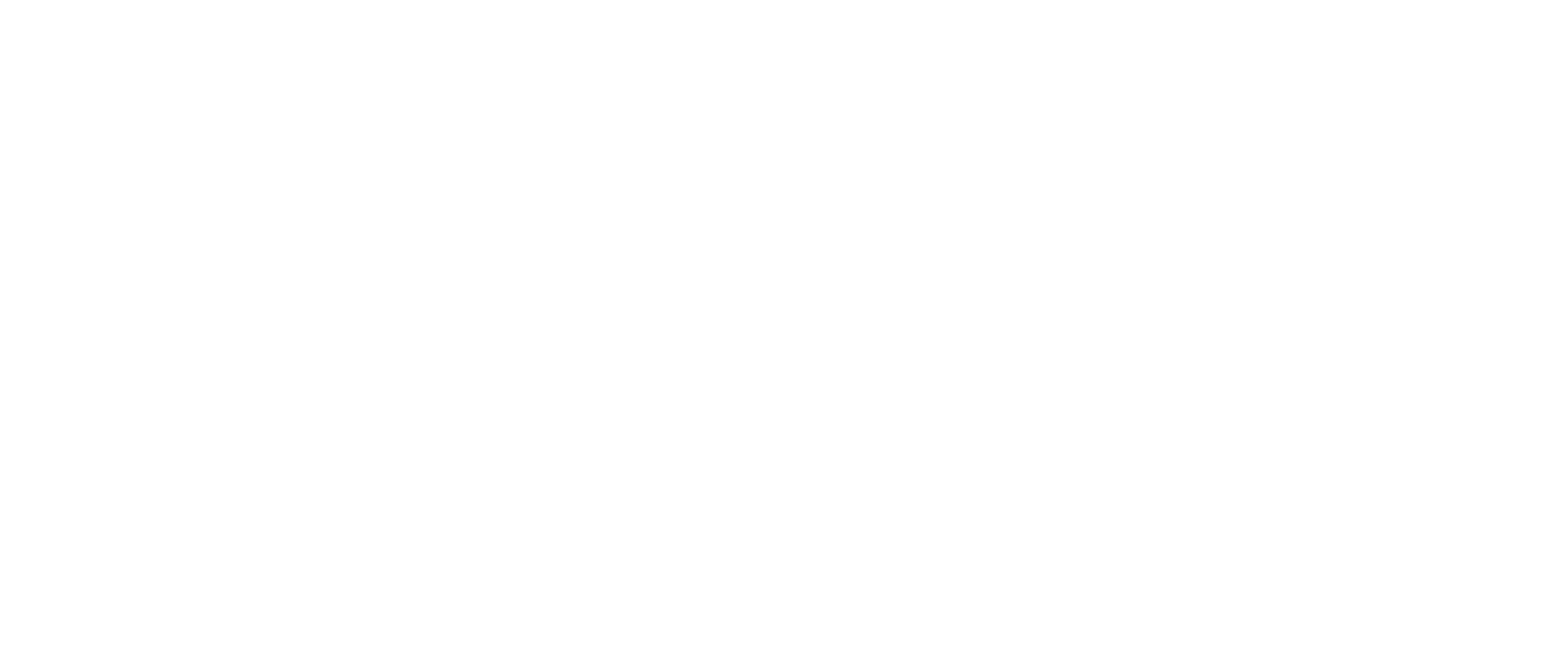Neugründung im Team
Elif (33), Klara (31) und Marco (29) haben vor sich vor fünf Jahren bei der Arbeit im Kindergarten kennen- und schätzen gelernt. Die gelernten Erzieherinnen und der Erzieher arbeiten zwar schon lange nicht mehr in derselben Einrichtung, aber bald wieder zusammen: Sie haben gemeinsam eine integrative Kindertagespflege gegründet.
Die Neugründung eines Unternehmens ist ein Kraftakt – insbesondere, wenn man allein dafür verantwortlich ist. Wieso also nicht mit anderen zusammentun, um mehr Power zu entfalten? Die Neugründung als Team ist eine weitere Gründungsform, wenn auch eine Sonderform.
Sie hat viele positive Seiten: Jedes Teammitglied trägt mit seinen individuellen Stärken und Fachkenntnissen zum Unternehmenserfolg bei. Durch die verschiedenen Backgrounds gibt es von Anfang an ein breites Netzwerk, das dem Business Anschubhilfe leistet. Das Planen und Arbeiten in der Gruppe fördert zudem die Motivation und kreative Ideen.
Damit die Neugründung im Team gelingt, muss die Chemie zwischen den Mitgründerinnen und Mitgründern stimmen. Sie sollten nicht nur persönlich, sondern auch fachlich auf einer Wellenlänge sein.
Während die alleinige Gründung viel Flexibilität und Unabhängigkeit verspricht, können die Meinungen in einem Gründungsteam zuweilen auseinandergehen. Es gibt ein erhöhtes Risiko für Konflikte und Kompromisse, mit denen nicht immer alle zufrieden sind. Außerdem haften die Mitgründerinnen und Mitgründer gegenseitig, was eine besondere Verantwortung mit sich bringt. Da Arbeitsabläufe oder Entscheidungen gemeinsam diskutiert werden müssen, ist der Kommunikationsaufwand entsprechend hoch.
Welche Voraussetzungen gibt es bei der Neugründung im Team?
- Wenn Sie ein Unternehmen im Team gründen, schließen Sie gemeinsam einen Vertrag. In ihm festgehalten sind die Rechte und Pflichten der Gründerinnen und Gründer, das jeweils eingebrachte Kapital, die Geschäftsanteile und die Verfügung darüber, Haftung, Gewinnverteilung sowie die Abfindung, wenn eine Gesellschafterin oder ein Gesellschafter ausscheidet.
- Genauso wie bei der Neugründung als Einzelperson ist auch in der Team-Variante ein Businessplan unverzichtbar, um das Unternehmenskonzept transparent darzulegen. Dieser sollte zusätzlich die Fachkenntnisse und Skills der einzelnen Mitgründerinnen und Mitgründer sowie die (sinnvolle) Aufteilung der Geschäftsführungsgehälter berücksichtigen.
- In puncto Finanzierung ist bei Neugründungen im Team häufig ein insgesamt höheres Eigenkapital vorhanden als bei einer Einzelperson, weil mehr Personen involviert sind.
Zu wem passt die Neugründung im Team?
Sie haben eine innovative Idee für ein Unternehmen, möchten die Verantwortung aber nicht allein auf Ihren Schultern tragen? Dann könnte eine Neugründung im Team die richtige Gründungsart für Sie sein. Sie sollten keine Probleme damit haben, Kompromisse einzugehen sowie Aufgaben und Verantwortlichkeiten gleichberechtigt im Team aufzuteilen.