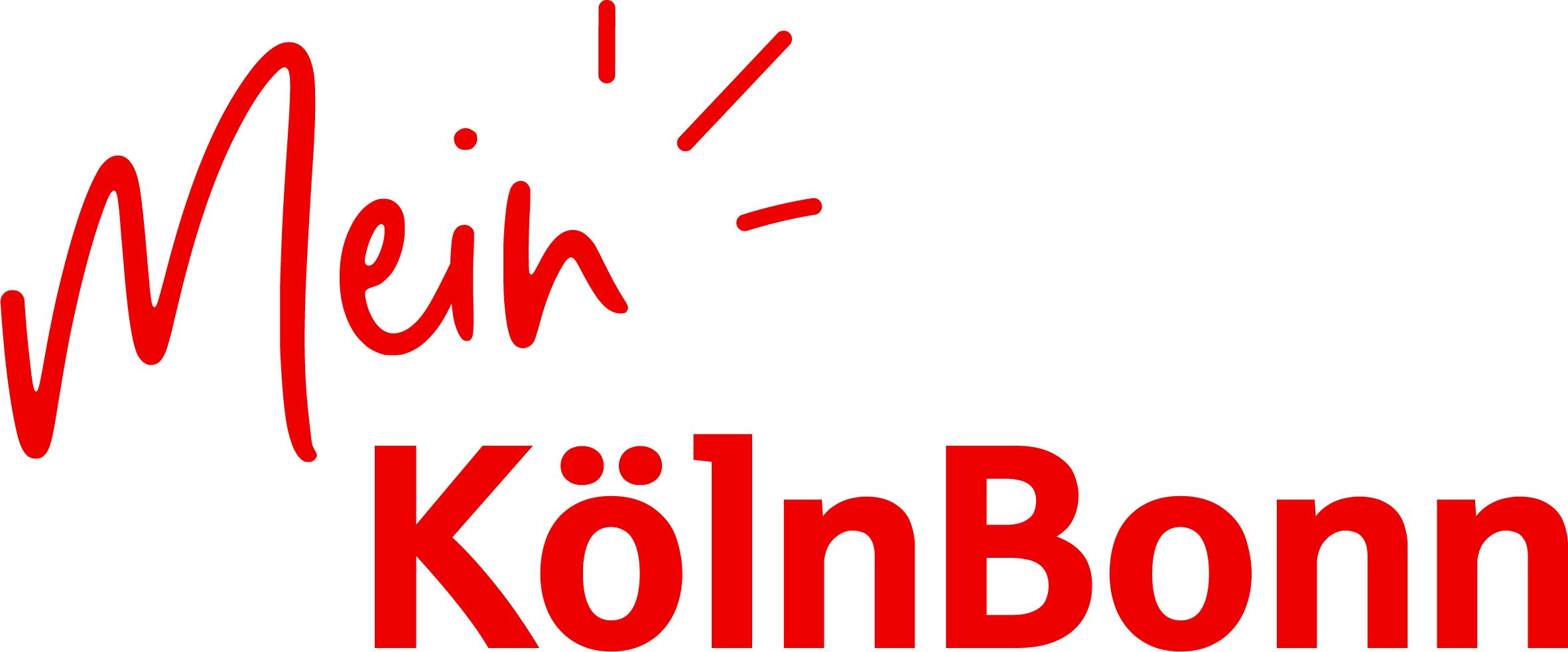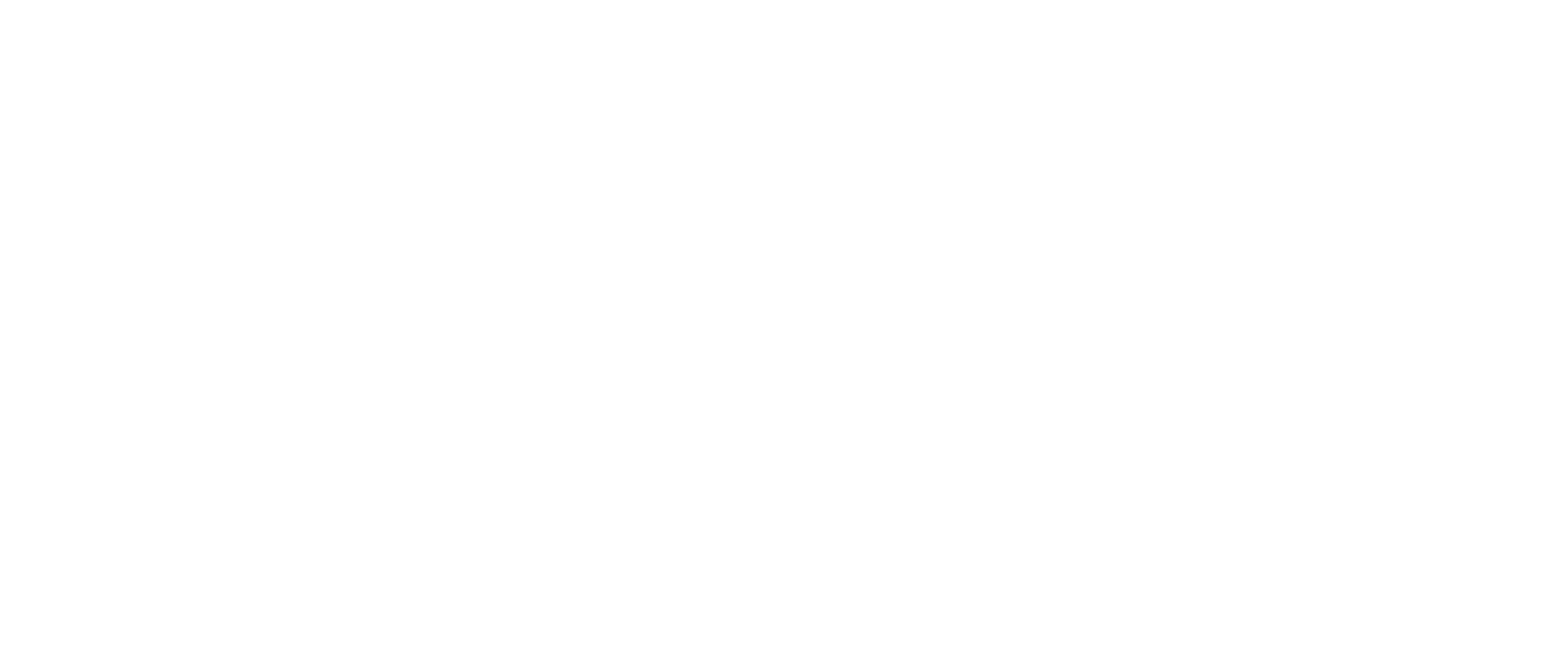Was ist eine Renovierung?
Beim Renovieren stehen Arbeiten mit geringerem Arbeitsumfang im Vordergrund – etwa eine kleine Reparatur in der Wohnung oder Maßnahmen, die die Immobilie optisch wieder aufwerten. Es handelt sich dabei um Arbeiten, die meist eigenständig durchgeführt werden können. Man spricht auch von Schönheitsreparaturen.
Zur Renovierung gehören u.a. folgende Maßnahmen:
- neuen Boden verlegen
- neue Farbe auf Fenster und Türen anbringen
- Tapezieren oder Streichen von Wänden
Was ist eine Modernisierung?
Das Modernisieren umfasst aufwändigere Arbeiten als eine Renovierung. Ziel ist es, die Immobilie auf den neusten Stand zu bringen. Dies führt zu mehr Wohnkomfort und mitunter auch zu einer Wertsteigerung des Objekts.
Oft geht mit der Modernisierung eine Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäues einher. Damit kann sich eine Modernisierung sogar positiv auf die Energie-Ausgaben auswirken.
Zum Modernisieren gehören unter anderem folgende Maßnahmen:
- Brandschutz-Maßnahmen verbessern
- Wärmeschutzfenster einsetzen
- Bad erneuern
Was ist eine Sanierung?
Eine Sanierung erfolgt in der Regel, wenn konkrete Mängel vorliegen. Betroffen sind meist ältere Gebäude. Schäden wie Schimmel, Feuchtigkeit oder eine kaputte Bausubstanz sollten von Fachkräften beseitigt und ausgebessert werden.
Die Kernsanierung beschreibt eine grundlegende Sanierung der Immobilie, bei der diese komplett instandgesetzt wird. Entsprechend hoch ist der Arbeitsaufwand.
Die energetische Sanierung betrifft Umbaumaßnahmen, die das Gebäude in Sachen Energieeffizienz auf den aktuellen Stand bringt.
Zum Sanieren gehören u.a. folgende Maßnahmen:
- Beseitigung von Schimmel
- Fassade reparieren
- Tausch von Heizungsanlagen
Renovieren, Modernisieren, Sanieren – in der Praxis kaum trennbar
Auch wenn zwischen bloßem Tapezieren und einem Heizungstausch ein großer Aufwands- und Kostenunterschied liegt: Im Alltag verschwimmt der Unterschied zwischen Renovieren, Modernisieren und Sanieren, denn häufig bedingt die eine Maßnahme die nächste. Wenn Sie beispielsweise an der Haus-Fassade Schönheitsreparaturen vornehmen und dabei mehr als zehn Prozent des Putzes erneuern, müssen Sie laut Gebäudeenergiegesetz unter Umständen auch die Dämmung verbessern.
Rechtliche Unterschiede beim Mieten und Vermieten
Für Mieterinnen und Mieter gilt:
Einige Renovierungsmaßnahmen sind im Rahmen des Mietvertrags erlaubt. Wenn Sie also die Wände Ihrer Mietwohnung blau streichen möchten, können Sie das auf eigene Kosten tun. Zu beachten ist jedoch, dass die Bausubstanz nicht ohne Erlaubnis der Vermieterin oder des Vermieters verändert werden darf. Der ursprüngliche Zustand der Wohnung muss beim Auszug wiederhergestellt werden. Unter Umständen sind Sie dazu verpflichtet, die Wände der Wohnung beim Auszug in einer neutralen Farbe zu streichen. Details sind im Mietvertrag festgehalten.
Auch kleine Reparaturen innerhalb der Wohnung müssen Sie selbst bezahlen, wenn der Mietvertrag eine gültige Klausel für Kleinreparaturen enthält.
Für Vermieterinnen und Vermieter gilt:
Als Vermieterin oder Vermieter sind Sie in der Regel verpflichtet, das Wohngebäude instand zu halten und Mängel oder Schäden zu beseitigen. Gleiches gilt für einen vorschriftsgemäßen Brandschutz. Hinzu kommen Sanierungspflichten im Rahmen von gesetzlichen Vorgaben wie dem Gebäudeenergiegesetz.
Sollte beispielsweise eine Modernisierung der Heizung oder Fenster nötig sein, müssen Sie diese veranlassen. Um einen solchen Umbau zu finanzieren, können Sie grundsätzlich die Miete erhöhen. Für einige Maßnahmen – besonders solche, die die Energieeffizienz betreffen – können Sie zudem Förderungen beantragen. Bei größeren Sanierungsarbeiten liegt die Verantwortung für die Umsetzung und Finanzierung vor allem bei Ihnen als Vermieterin oder Vermieter.