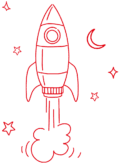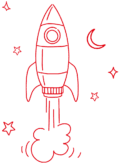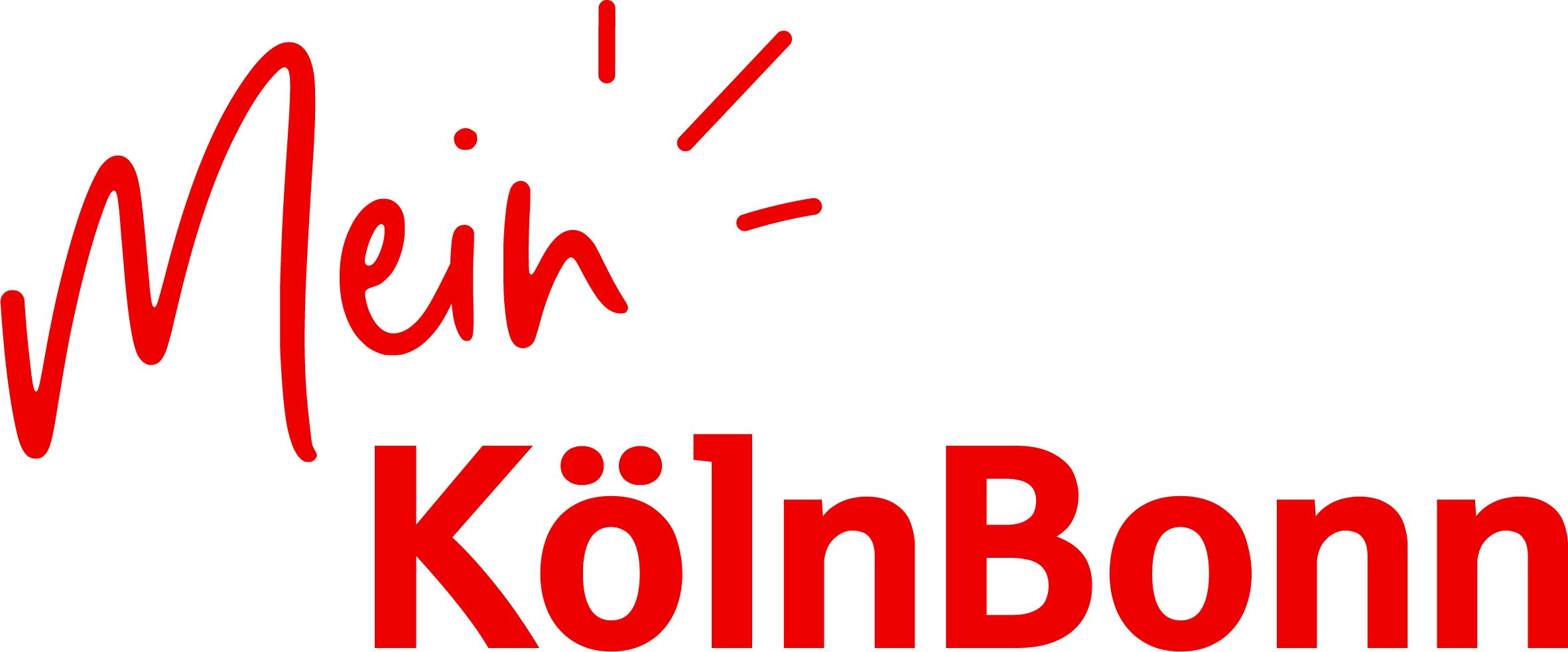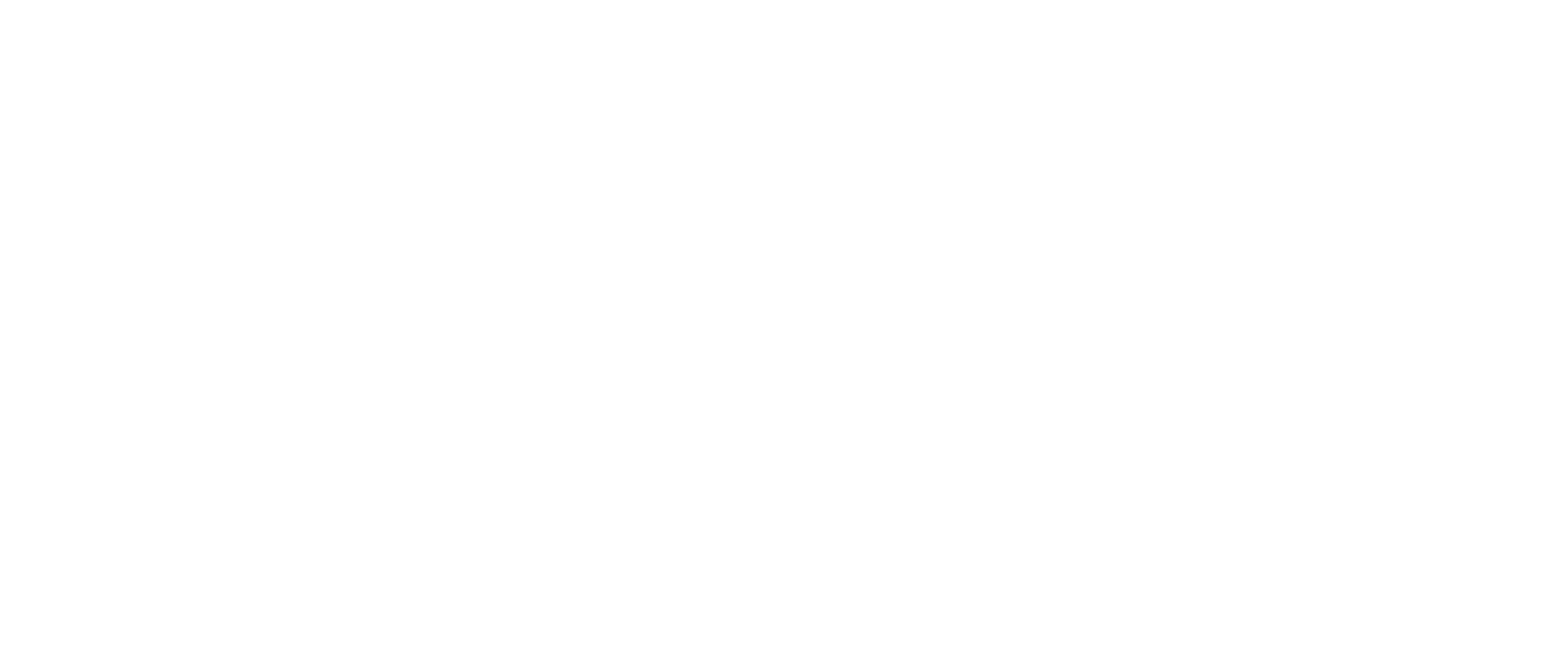Das steckt hinter der E-Rechnungspflicht
Seit dem 1. Januar 2025 müssen grundsätzlich alle Unternehmen in DeutschlandE-Rechnungen empfangen und verarbeiten können. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass E-Rechnungen seit dem nicht mehr abgelehnt werden dürfen. Das war bis letztes Jahr noch möglich, wenn die Rechnung nicht im gewünschten Format vorlag.
Selbständige und Unternehmen, die im B2B-Bereich tätig sind und ihren Sitz in Deutschland haben, dürfen ihre Rechnungen zukünftig außerdem nur noch als E-Rechnung versenden.
Mit dieser Umstellung soll der Geschäftsverkehr digitaler, transparenter und auch effizienter gestaltet werden. Die E-Rechnung ist dabei auch ein Schritt, um Unternehmen von bürokratischen Hürden zu befreien. So ist es auch im Wachstumschancengesetz festgelegt, das Deutschland modernisieren, zukunftssicher und klimaneutraler machen soll.
Wer muss eine E-Rechnung erstellen?
Unternehmen und Selbständige (auch Freiberuflerinnen und Gewerbetreibende), die Rechnungen an andere Unternehmen stellen, also im B2B-Bereich tätig sind, sollen seit diesem Jahr nur noch E-Rechnungen erstellen – vorausgesetzt sie selbst und auch der Rechnungsempfänger sind in Deutschland ansässig.
Gibt es Ausnahmen?
Ausgenommen von der E-Rechnungspflicht sind
- Rechnungen an Endverbraucherinnen und -verbraucher (B2C)
- Rechnungen unter 250 Euro (brutto)
- Rechnungen für Leistungen, die von einem Kleinunternehmen erbracht werden
- Rechnungen für Leistungen an juristische Personen, die nicht unternehmerisch tätig sind (oft Vereine)
- Fahrausweise, die als Rechnung gelten
- Übergangsregelungen – das sind Regelungen, die z. B. individuell zwischen einem Unternehmen und einem Lieferanten getroffen werden